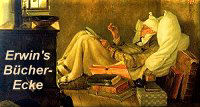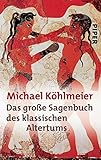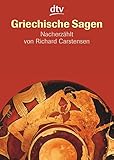Sagen und Legenden
Elfen, Feen und Könige
Der Erlkönig
Johann Wolfgang von Goethe
Der Tod eines Kindes in den Armen seines Vaters, was für eine schreckliche Geschichte, die Johann Wolfgang von Goethe für sein Gedicht, seine Ballade, Der Erlkönig auswählte. Johann Gottfried Herder hatte eine dänische Geschichte übersetzt, in der von einem Ellerkonge, einem Elfenkönig, die Rede war. Da das alt-dänische "elle" offenbar Erle und auch Elfe bedeuten kann, machte er daraus den Erlkönig.
In der dänischen mystischen Ballade  hier.
hier.
Die Stadt der dichterischen Muse scheint damals Weimar gewesen zu sein. Das sogenannte Viergestirn der Weimarer Klassik bildeten
Erlkönigs Tochter
reitet ein Herr Oluf zu seiner Hochzeit. Unterwegs trifft er auf tanzende Elfen auf grünem Land. Die Tochter des Erlkönigs fordert ihn zum Tanz auf, aber Oluf lehnt ab, da er auf dem Weg zu seiner Hochzeit ist. Sie bietet ihm zwei güldne Sporne, ein Hemd von Seide, gebleicht mit Mondenschein und schließlich einen Haufen Goldes, aber er lehnt immer noch ab. Enttäuscht verflucht sie ihn mit Seuche und Krankheit. Seine Braut findet Oluf schließlich bei seiner Mutter, tot unter einem scharlachroten Tuch. Den deutschen Text der Ballade von Johann Gottfried Herder finden SieDie Stadt der dichterischen Muse scheint damals Weimar gewesen zu sein. Das sogenannte Viergestirn der Weimarer Klassik bildeten
Als Goethe im nur 20 km entfernten Jena weilte, soll ein Bauer aus Kunitz, einem nahen Dorf, mit seinem kranken Kind zu einem Arzt nach Jena geritten sein. Das hat ihn zu dem Gedicht inspiriert, und im Gasthaus zur Grünen Tanne hat er es im Jahr 1782 niedergeschrieben. Das tragische Gedicht Erlkönigs Tochter von Herder hat er wahrscheinlich schon gekannt, und es hat sicher auch zur Inspiration beigetragen.
Der Text des Gedichts Erlkönig von Johann Wolfgang von Goethe
Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?
Es ist der Vater mit seinem Kind.
Er hat den Knaben wohl in dem Arm,
er fasst ihn sicher, er hält ihn warm.
Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht?
»Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht?
Den Erlenkönig mit Kron’ und Schweif?«
»Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif.«
»Du liebes Kind, komm, geh mit mir!
Gar schöne Spiele spiel’ ich mit dir,
manch bunte Blumen sind an dem Strand,
meine Mutter hat manch gülden Gewand.«
»Mein Vater, mein Vater, und hörest du nicht,
Was Erlenkönig mir leise verspricht?«
»Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind,
in dürren Blättern säuselt der Wind.«
Es ist der Vater mit seinem Kind.
Er hat den Knaben wohl in dem Arm,
er fasst ihn sicher, er hält ihn warm.
Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht?
»Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht?
Den Erlenkönig mit Kron’ und Schweif?«
»Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif.«
»Du liebes Kind, komm, geh mit mir!
Gar schöne Spiele spiel’ ich mit dir,
manch bunte Blumen sind an dem Strand,
meine Mutter hat manch gülden Gewand.«
»Mein Vater, mein Vater, und hörest du nicht,
Was Erlenkönig mir leise verspricht?«
»Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind,
in dürren Blättern säuselt der Wind.«
»Willst, feiner Knabe, du mit mir gehn?
Meine Töchter sollen dich warten schön.
Meine Töchter führen den nächtlichen Reihn
und wiegen und tanzen und singen dich ein.«
»Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort
Erlkönigs Töchter am düstern Ort?«
»Mein Sohn, mein Sohn, ich seh’ es genau:
Es scheinen die alten Weiden so grau.»
»Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt,
und bist du nicht willig, so brauch’ ich Gewalt.«
»Mein Vater, mein Vater, jetzt fasst er mich an!
Erlkönig hat mir ein Leids getan!«
Dem Vater grauset’s, er reitet geschwind.
Er hält in Armen das ächzende Kind,
erreicht den Hof mit Mühe und Not,
in seinen Armen das Kind war tot.
Meine Töchter sollen dich warten schön.
Meine Töchter führen den nächtlichen Reihn
und wiegen und tanzen und singen dich ein.«
»Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort
Erlkönigs Töchter am düstern Ort?«
»Mein Sohn, mein Sohn, ich seh’ es genau:
Es scheinen die alten Weiden so grau.»
»Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt,
und bist du nicht willig, so brauch’ ich Gewalt.«
»Mein Vater, mein Vater, jetzt fasst er mich an!
Erlkönig hat mir ein Leids getan!«
Dem Vater grauset’s, er reitet geschwind.
Er hält in Armen das ächzende Kind,
erreicht den Hof mit Mühe und Not,
in seinen Armen das Kind war tot.
Es gibt auch Vertonungen in Liedform.
Eine neue Version gibt es jetzt KI-generiert in Ton und Bild. Der mystische Ritt eines Vaters mit seinem Sohn, die dem mächtigen Erlkönig begegnen, alles erstellt von künstlicher Intelligenz, auch der Gesang.
Eine neue Version gibt es jetzt KI-generiert in Ton und Bild. Der mystische Ritt eines Vaters mit seinem Sohn, die dem mächtigen Erlkönig begegnen, alles erstellt von künstlicher Intelligenz, auch der Gesang.
Mit unserer aufgeklärten, weltlichen Sicht auf die Welt interpretieren wir das, was der Knabe sagt, natürlich als Halluzinationen, als Fieber-Delirium, Fieberwahn oder Fieberträume. Goethe spielt hier aber auf Aussagen über eine mystische, mythische Welt im Bereich zwischen Leben und Tod an, was das Gedicht nicht nur tragisch, sondern auch gruselig macht. Im Aberglauben früherer Jahrhunderte hausen in Sümpfen und sumpfigen Erlenbrüchen eben Irrlichter, Kobolde, aber auch Feen und Elfen.
Gevatter Tod in Gestalt des Erlkönigs lockt das Kind mit schönen Versprechungen. Und auch wer nicht an Mystik glaubt, ist doch versucht, dieses Gruseln zuzulassen. Fehlt es doch in unserer realistischen Welt oft an Mystik und Spiritualität. Wie zu erwarten blieb es in unserer Welt des Misstrauens nicht aus, dass manche den Erlkönig oder gar den Vater als pädophilen Mann, Vergewaltiger, und die Wahnträume als Alptraum eines Opfers sexueller Gewalt betrachten, oder gar den guten Vater als zwiespältige gespaltene Persönlichkeit. Die Zeilen »Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt, und bist du nicht willig, so brauch’ ich Gewalt.« bekommen so eine ganz andere Bedeutung, tiefenpsychologische Küchenpsychologie.
Auf den Text gibt es zahlreiche Verballhornungen mit Schwarzem Humor, was nicht jedermanns Sache ist. Um 1955 schrieb Heinz Erhardt eine abgekürzte Form mit etwas besserem Ausgang:
Heinz Erhardt eine abgekürzte Form mit etwas besserem Ausgang:
… Erreicht den Hof mit Müh' und Not, der Knabe lebt, das Pferd ist tot!
Widerstreit zwischen der Vernunft in Renaissance und Aufklärung und der Mystik des Mittelalters
Im Gespräch zwischen Vater und Sohn erkennt man den Widerstreit zwischen dem Zeitalter der Aufklärung und der Mystik des Mittelalters. Der Vater mit seinem rationalen Denken sieht statt des Erlenkönigs mit Krone und Schweif in der Natur den Nebelstreif, hört statt den Versprechen des Erlenkönigs den Wind, der in den dürren Blättern säuselt und statt Erlkönigs Töchter am düsteren Ort die alten Weiden so grau. Zum Schluss graust es den Vater doch, trotz aller aufgeklärter Vernunft. Die Mystik siegt, der Erlkönig tötet den Sohn. Die Aufklärung musste schließlich erkennen, dass man mit Vernunft und Rationalität nicht alles erklären kann. Das Leben bleibt mystisch, bis heute.Gevatter Tod in Gestalt des Erlkönigs lockt das Kind mit schönen Versprechungen. Und auch wer nicht an Mystik glaubt, ist doch versucht, dieses Gruseln zuzulassen. Fehlt es doch in unserer realistischen Welt oft an Mystik und Spiritualität. Wie zu erwarten blieb es in unserer Welt des Misstrauens nicht aus, dass manche den Erlkönig oder gar den Vater als pädophilen Mann, Vergewaltiger, und die Wahnträume als Alptraum eines Opfers sexueller Gewalt betrachten, oder gar den guten Vater als zwiespältige gespaltene Persönlichkeit. Die Zeilen »Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt, und bist du nicht willig, so brauch’ ich Gewalt.« bekommen so eine ganz andere Bedeutung, tiefenpsychologische Küchenpsychologie.
Auf den Text gibt es zahlreiche Verballhornungen mit Schwarzem Humor, was nicht jedermanns Sache ist. Um 1955 schrieb
… Erreicht den Hof mit Müh' und Not, der Knabe lebt, das Pferd ist tot!
Bücher: Sagen und Legenden
| Bücher | Elektronik, Foto |
| Musik-CDs | DVDs, Blu-ray |
| Spielzeug | Software |
| Freizeit, Sport | Haus und Garten |
| Computerspiele | Küchengeräte |
| Essen und Trinken | Drogerie und Bad |